Alle Bücher der Literaturtage 2021 sind empfehlenswert, das haben die Lesungen, die Gespräche und die Rezensionen zu den Romanen gezeigt. Wir hatten bereits Blogbeiträge mit Informationen zu jeder einzelnen Lesung. Aber einige Romane möchte ich hier noch einmal aus eigener Lektüre empfehlen. Die Auswahl ist dabei eher zufällig, denn ich habe nicht alle Bücher der 10 Veranstaltungen gelesen, einige möchte ich noch.
Lena Gorelik: Wer wir sind
Lena Gorelik hat mit ihrem autobiographischen Roman ihre sehr persönlichen Erfahrungen und Gefühle niedergeschrieben: Kindheit in St. Petersburg, dann mit 11 Jahren Ausreise und Ankunft in einem fremden Land mit anderen Sitten und vor allem einer anderen Sprache. Mehr zum Roman hier.

Die Szenen, die mich besonders berührt haben, waren die, die das Verhältnis zu den Eltern betreffen. Die sind mit ihren Kindern in ihr Sehnsuchtsland ausgewandert, bleiben aber im „Westen“ die Fremden. Auf der Tochter liegt der Druck, die großen Erwartungen der Eltern, die Anpassung an die neue Heimat, die Scham über die Wohn- und Lebensverhältnisse im Flüchtlingsheim, der Zwiespalt und das Unverständnis zwischen den Generationen, dazu die ganz normalen Teenager-Probleme und Eltern-Kind-Konflikte, wie sie wohl jeder mehr oder weniger kennt. Das ist so berührend und klar geschrieben. Und alles ist umrahmt von der Liebe in dieser Familie, wobei zwischen den Generationen meist die Worte dafür fehlen. Aber Lena Gorelik hat das Buch auch als eine Liebeserklärung an die Eltern geschrieben. So habe ich es jedenfalls gelesen. Sehr bewegend. Dieses Buch hätte ich gerne meiner Mutter empfohlen und mit ihr darüber gesprochen.
Zora Del Buono: Die Marschallin
Auch ein Roman über ein Stück eigene Familiengeschichte, es geht um die gleichnamige Großmutter der Schweizer Autorin, eine bemerkenswerte Frau voller Widersprüche. Mehr dazu hier.

Ich musste feststellen, dass ich nur sehr wenig über die bewegte Geschichte des Balkan und Italiens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weiß. 1. Weltkrieg, Faschismus, 2. Weltkrieg – das war zwar alles mal Thema des Geschichtsunterrichts, aber nicht aus der südeuropäischen Perspektive. Da fehlte mir einiges an Hintergrundwissen – nicht dass das zum Verständnis des Romans unbedingt notwendig wäre. Aber das Buch stieß mich auf diese Lücke – nun ja, sicher eine von vielen. Aber dieser Teil der europäischen Geschichte hat schließlich auch Auswirkungen bis heute. Nein, das ist eigentlich nicht das Thema des Romans, aber die charismatische Hauptfigur steht für die Zerrissenheit, die inneren und äußeren Kämpfe, für die Verstrickungen und gesellschaftlichen Brüche dieser Zeit.
Felicitas Hoppe: Fieber 17
Die Autorin las aus ihrer Erzählung Fieber 17 vor, aber das größere Interesse beim anschließenden Gespräch und genauso in den Medien lag bei ihrem Roman „Die Nibelungen“ – den ich aber bisher noch nicht gelesen habe (liegt aber auf meinem SuB, dem Stapel ungelesener Bücher). Mehr zu beiden Büchern hier.

An dem kleinen Büchlein „Fieber 17“ hat mich eigentlich der angehängte Essay am meisten beeindruckt. Den empfehle ich jedem, der sich für das Erinnern an die eigene Kindheit interessiert, für die Frage, wie Erinnerungen uns prägen und wie sich unsere Erinnerungen verändern, allein weil wir darüber Nachdenken, davon Erzählen oder eben Schreiben wie die Autorin. Hat mir einiges zu Denken gegeben.
Marente de Moor: Phon
Der Roman der niederländischen Autorin hat mich sehr überrascht. Der Inhalt ist im Blogbeitrag zur Lesung schon erzählt (hier).
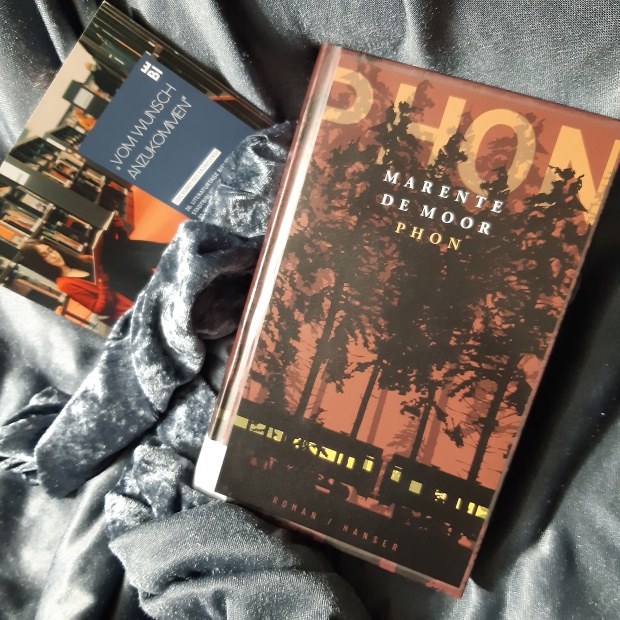
Mich interessiert zurzeit das Genre nature writing in der Belletristik, und hier habe ich ein großartiges Beispiel dafür gefunden. Die Natur aus der Sicht der Ich-Erzählerin beschrieben: als Zuflucht, als Spiegel für ihre Gefühle, als mythischer Ort. Die Natur dient aber als reine Projektionsfläche: Es ist der Mensch, der das Göttliche darin finden will – oder auch das Dämonische zu erkennen meint. Ob Pope, selbst ernannte Schamanin oder Atheist – alle erklären sich die Natur so, dass es zu ihrem jeweiligen Weltbild passt. Dabei sind der Natur die Menschen egal, sie ist zu ihnen genauso gnädig und brutal wie zu allen Lebewesen.
Der Ich-Erzählerin sind die Gewissheiten verloren gegangen, sie sucht neuen Halt. Zwischen Erinnerung und Verdrängung lauern ein Trauma und der Verlust — irgendetwas ist vor einiger Zeit geschehen, das das Paradies endgültig zerstört hat. Oder die Illusion vom Paradies.
Marente de Moor lässt ihre Protagonistin sprunghaft und scheinbar schlicht erzählen, findet aber besonders für die Beschreibung der Natur eine poetische Sprache. Das hat mir sehr gut gefallen. Es wird nicht alles erklärt. Läuten die seltsamen Töne die Apokalypse ein oder sind sie nur Einbildung, gibt es eine naturwissenschaftlich-logische Erklärung oder bleibt uns das Rätsel. Bringt der Lokomotivführer die Chance zu einem neuen Anfang oder ist auch er nur ein Traum, eine Phantasie? Und was genau ist passiert an dem Tag, über den niemand sprechen will.
Ich finde, dieser Roman um Menschen, die sich mehr oder weniger mit Absicht aus dem Zeitgeschehen zurückgezogen haben und jetzt in mehrfacher Hinsicht aus der Zeit gefallen sind – in ihrer eigenbrötlerischen Lebensweise, ihrer Abkapselung von der Gesellschaft, aber auch psychisch in ihrer Verwirrtheit und ihrem Gedächtnisverlust – wirft auch ein erstaunliches Bild auf unsere aktuelle Situation. Wie gehen wir mit dem Alleinsein um? Mit der Erosion unseres festgefahrenen Weltbildes? Mit unserem romantisierenden, vermenschlichenden Naturverständnis? Und unserer gleichzeitigen Tendenz, das zu zerstören, was wir vorgeben zu lieben? Wie reagieren wir auf die Gefahr, auf die wir nicht vorbereitet sind, obwohl (oder weil?) wir doch alles zu wissen glauben und uns durch den wahren Glauben, die eigene Stärke oder besondere Kenntnisse eigentlich geschützt wähnen? Sagt uns zumindest unser Bauchgefühl. Die Suche nach dem Ort, an dem wir alle menschliche Unbill einfach vergessen können, damit endlich alles vorbei ist – wer versteht das nicht.
„Aber sie sind sich ihrer Sache sicher, wie Esther. Meine drei Tischgenossen haben alle Rätsel gelöst. Egal, was man ihnen erzählt, sie nicken immer nur eifrig, und du wirst deine Geschichte nicht los, weil sie sie schon kennen, schlimmer noch, sie wissen darüber Bescheid, weil sie über alles Bescheid wissen. Sie haben den Durchblick, Lokführer. Ich bin hier allein mit meinen Zweifeln.“
(Seite 308)
Aber das sind meine Fragen und Gedanken beim Lesen dieses Romans. Es ist an jedem Leser, mit welcher Gewissheit oder Interpretation er aus dem Buch geht.
Ich empfehle es sehr.
HilDa